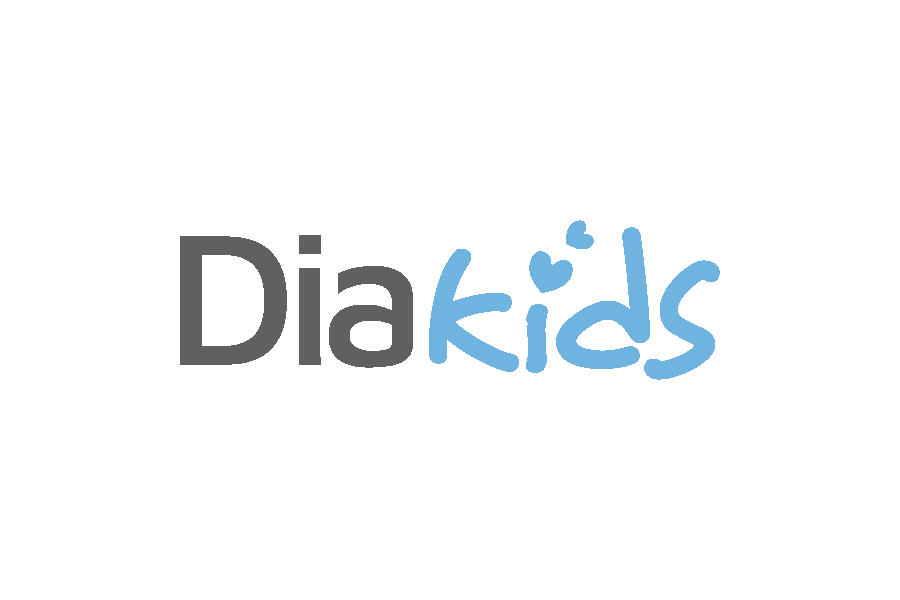Allgemein
FAQ und Community
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
In unseren FAQs finden Sie Antworten auf viele häufige Fragen rund um das Leben mit Diabetes. Wir bieten Ihnen schnelle und verständliche Informationen zu Themen wie Blutzuckermessung, Insulintherapie und Alltag mit Diabetes.
Community und Austausch
Wenn du Fragen hast oder Unterstützung brauchst, sind wir gerne für dich da. Schreib uns einfach über unsere Social-Media-Kanäle oder nutze unser Kontaktformular. Wir nehmen uns Zeit für deine Anliegen und begleiten dich mit Rat und Erfahrung.
Fragen & Antworten (FAQ)
Wenn Ihr Kind plötzlich sehr viel mehr Durst hat als sonst, ist das ein wichtiges Warnzeichen, das auf Typ 1 Diabetes hinweisen kann. Diese Autoimmunerkrankung zerstört die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse, wodurch der Körper Insulin nicht mehr ausreichend herstellen kann. Ohne Insulin kann der Zucker nicht in die Körperzellen gelangen und sammelt sich im Blut an. Um den erhöhten Blutzuckerspiegel auszuscheiden, erhöhen die Nieren die Harnausscheidung, was zu häufigem Wasserlassen führt. Um diesen Flüssigkeitsverlust auszugleichen, trinkt das Kind deutlich mehr als zuvor.
Neben vermehrtem Durst treten häufig Müdigkeit, Gewichtsverlust und allgemeine Schwäche auf. Die Müdigkeit entsteht, weil die Körperzellen trotz hoher Blutzuckerwerte keine Energie erhalten. Der Gewichtsverlust ist darauf zurückzuführen, dass der Körper anfängt, Fett und Muskelmasse abzubauen, um Energie zu gewinnen.
Sollten diese Symptome bei Ihrem Kind auftreten, ist es wichtig, zeitnah einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen, damit eine Blutzuckerbestimmung durchgeführt werden kann und gegebenenfalls eine Therapie eingeleitet wird. Ein frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Typ 1 Diabetes ist entscheidend, um schwerwiegende Komplikationen wie eine Ketoazidose zu vermeiden. [1]
Kinder mit Typ 1 Diabetes dürfen Süßigkeiten und zuckerhaltige Lebensmittel essen, wenn dies gut geplant wird. Entscheidend ist die genaue Berechnung der Kohlenhydrate, da diese den Blutzuckerspiegel maßgeblich beeinflussen. Die Menge an Kohlenhydraten bestimmt, wie viel Insulin das Kind benötigt, um den Blutzucker im Zielbereich zu halten.
Süßigkeiten enthalten meist schnell verdauliche Zucker, die den Blutzucker rasch ansteigen lassen. Deshalb muss die Insulindosis entsprechend angepasst werden. Diabetesberaterinnen und Diabetesberater können dabei helfen, den Kohlenhydratgehalt richtig einzuschätzen und die passende Insulindosis zu berechnen.
Eine ausgewogene Ernährung mit verschiedenen Lebensmitteln bleibt wichtig. Zuckerhaltige Snacks können Teil der Ernährung sein, solange sie in den Kohlenhydratplan integriert werden. So bleibt die Lebensqualität erhalten, und das Kind kann ein normales, erfülltes Leben führen. [2]
Viele Kinder können ab etwa sechs bis acht Jahren beginnen, selbstständig ihren Blutzucker zu messen und Insulin zu spritzen. Das genaue Alter hängt von der individuellen Entwicklung, den motorischen Fähigkeiten und dem Verständnis des Kindes ab.
Eltern und Betreuungspersonen sollten das Kind geduldig und schrittweise an die Technik heranführen. Regelmäßiges Üben und eine altersgerechte Anleitung sind wichtig, damit das Kind Sicherheit gewinnt. Fachliche Unterstützung durch medizinisches Personal oder Diabetesberaterinnen und Diabetesberater erleichtert das Lernen.
Moderne Technologien wie kontinuierliche Glukosemesssysteme und Insulinpumpen unterstützen das Selbstmanagement und ermöglichen Kindern mehr Unabhängigkeit. Durch die zunehmende Eigenverantwortung gewinnt das Kind an Selbstvertrauen im Umgang mit der Erkrankung. [3]
Typische erste Symptome bei Typ 1 Diabetes sind starker Durst, häufiges Wasserlassen, Gewichtsverlust und Müdigkeit. Diese entstehen, weil der Körper aufgrund des Insulinmangels den Zucker nicht verwerten kann, was zu einem erhöhten Blutzucker führt.
Die Nieren versuchen, den Zucker durch vermehrtes Wasserlassen auszuscheiden, was zu Flüssigkeitsverlust und daraus folgend zu vermehrtem Durst führt. Da die Zellen keine Energie erhalten, fühlen sich betroffene Kinder oft müde und abgeschlagen. Der Gewichtsverlust resultiert daraus, dass der Körper Fett und Muskeln zur Energiegewinnung abbaut.
In einigen Fällen können auch Übelkeit oder Bauchschmerzen auftreten. Diese Symptome können auf eine gefährliche Stoffwechselentgleisung, die Ketoazidose, hinweisen, die sofort behandelt werden muss. Daher ist bei Verdacht eine schnelle ärztliche Abklärung besonders wichtig. [4]
Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die insulinproduzierenden Zellen zerstört. Diese Form ist bei Kindern die häufigste Diabetesart und erfordert eine lebenslange Insulintherapie.
Typ 2 Diabetes ist durch eine verminderte Insulinwirkung (Insulinresistenz) gekennzeichnet und tritt bei Kindern seltener auf. Er wird durch Übergewicht und Bewegungsmangel begünstigt. Bei Typ 2 Diabetes liegt zunächst meist eine Überproduktion von Insulin vor, doch die Körperzellen reagieren nicht mehr richtig darauf.
Die Behandlung von Typ 2 Diabetes bei Kindern besteht meist aus Ernährungsumstellung und mehr Bewegung, gegebenenfalls ergänzt durch Medikamente. Eine korrekte Diagnose durch einen Arzt oder eine Ärztin ist entscheidend, da die Therapie je nach Typ unterschiedlich ist. [5]
Die Blutzuckerkontrolle bei Kindern mit Typ 1 Diabetes ist ein zentraler Bestandteil der Behandlung und sollte in der Regel vor und nach den Mahlzeiten sowie bei körperlicher Aktivität erfolgen. Regelmäßige Kontrollen helfen dabei, den Blutzucker möglichst im Zielbereich zu halten und Hypo- oder Hyperglykämien zu vermeiden.
Besonders wichtig ist die Kontrolle vor dem Essen, um die Insulindosis an den aktuellen Blutzucker und die Kohlenhydrataufnahme anzupassen. Auch nach den Mahlzeiten gibt die Messung Aufschluss darüber, wie gut die Insulintherapie wirkt. Bei sportlichen Aktivitäten oder ungewohnten Belastungen ist eine zusätzliche Überprüfung sinnvoll, da Bewegung den Blutzucker stark beeinflussen kann.
Moderne kontinuierliche Glukosemesssysteme (CGM) erleichtern die Überwachung erheblich. Sie liefern kontinuierliche Werte und können bei Grenzwerten Alarm schlagen, sodass Unterzuckerungen frühzeitig erkannt und behandelt werden können. Das entlastet Familien und ermöglicht mehr Sicherheit im Alltag. [6]
Ein CGM-Sensor misst kontinuierlich den Glukosewert im Gewebe und überträgt diese Werte automatisch an ein Empfängergerät wie ein Smartphone oder eine Insulinpumpe. Dadurch erhalten Kinder und ihre Familien ein umfassendes Bild des Blutzuckerverlaufs über den Tag und die Nacht hinweg.
Der Sensor arbeitet über einen kleinen, meist schmerzfrei eingesetzten Faden unter der Haut, der die Glukosekonzentration im Interstitialfluid misst. Diese Werte werden alle paar Minuten aktualisiert und ermöglichen es, Trends und Schwankungen frühzeitig zu erkennen.
Besonders hilfreich sind die Alarmfunktionen, die vor Unterzuckerungen oder zu hohen Werten warnen. So können frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden, um gesundheitliche Risiken zu minimieren. CGM-Systeme unterstützen das Diabetesmanagement erheblich und verbessern die Lebensqualität vieler Kinder. [7]
Viele Pädagoginnen und Pädagogen sind nicht automatisch geschult, Insulin zu spritzen, da dies eine medizinische Handlung ist, die spezifische Kenntnisse und eine entsprechende Ausbildung erfordert. Um sicherzustellen, dass Kinder mit Diabetes auch im Kindergarten gut betreut sind, ist eine individuelle Absprache mit der Einrichtung wichtig.
Gemeinsam mit dem Kindergartenpersonal kann eine Lösung erarbeitet werden, zum Beispiel durch Schulungen, die das Team befähigen, Insulin zu spritzen oder Blutzucker zu messen. Alternativ kann eine qualifizierte Betreuungsperson engagiert werden, die diese Aufgaben übernimmt.
Das Ziel ist, dass das Kind auch während der Betreuungszeit sicher versorgt ist und die Eltern beruhigt sein können, wenn sie nicht vor Ort sind. Eine gute Kommunikation zwischen Eltern, Betreuungspersonen und Ärzten ist dabei zentral. [8]
Nein, ein gut eingestelltes Kind mit Typ 1 Diabetes kann fast alle Aktivitäten, inklusive Klassenfahrten, problemlos mitmachen. Wichtig ist eine gute Vorbereitung, bei der der Diabetesmanagementplan an die besonderen Bedingungen angepasst wird.
Dazu gehört die Planung der Insulindosen in Bezug auf Essen und Aktivität, die ausreichende Verfügbarkeit von Blutzuckermessgeräten, Traubenzucker und Medikamenten sowie die Information von Lehrkräften oder Begleitpersonen. Wenn das Betreuungspersonal geschult ist und die Eltern den Kindern Verantwortung und Selbstmanagement-Fähigkeiten vermitteln, können Klassenfahrten zu einem positiven Erlebnis werden.
Viele Schulen und Eltern kooperieren gut, um die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten. So bleibt die Teilnahme an sozialen Aktivitäten möglich, was für das Wohlbefinden und die Entwicklung sehr wichtig ist. [9]
Typ 1 Diabetes ist derzeit nicht heilbar, da das Immunsystem die insulinproduzierenden Betazellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört. Das bedeutet, dass betroffene Kinder lebenslang Insulin benötigen, um den Blutzucker zu regulieren.
Trotzdem ermöglichen moderne Therapieformen und Technologien ein ganz normales und aktives Leben. Mit Insulintherapie, regelmäßiger Blutzuckerkontrolle, angepasster Ernährung und Bewegung können Kinder ihren Alltag gestalten und auch sportlichen oder schulischen Aktivitäten nachgehen.
Forschungen zu Heilmethoden wie der Stammzelltherapie oder Immunmodulation laufen, sind aber aktuell noch nicht für die Praxis verfügbar. Bis dahin liegt der Fokus auf bestmöglicher Behandlung und Unterstützung, damit Kinder gesund und selbstbestimmt leben können. [10]
Die Berechnung von Broteinheiten, kurz BE, ist für Menschen mit Typ 1 Diabetes eine wichtige Methode, um die Insulindosis passend zur Mahlzeit zu bestimmen. Eine Broteinheit entspricht dabei 12 Gramm verwertbaren Kohlenhydraten. Das genaue Zählen der Kohlenhydrate hilft dabei, den Blutzucker nach dem Essen im Zielbereich zu halten.
Um die BE zu berechnen, sollten alle Lebensmittel auf dem Teller auf ihren Kohlenhydratgehalt überprüft werden. Dabei sind nicht nur offensichtliche Zuckerquellen wie Süßigkeiten wichtig, sondern auch Brot, Reis, Nudeln, Obst und Gemüse mit höherem Stärkeanteil. Hilfreich sind BE-Tabellen, Nährwertangaben auf Verpackungen oder Apps, die den Kohlenhydratgehalt von Lebensmitteln angeben. Sobald die Gesamtmenge der Kohlenhydrate in Gramm bekannt ist, wird diese durch 12 geteilt, um die BE zu ermitteln.
Anhand der berechneten BE kann die notwendige Insulinmenge bestimmt werden. Diese Berechnung sollte gemeinsam mit dem behandelnden Diabetesteam erlernt und regelmäßig überprüft werden, da individuelle Faktoren wie Insulinsensitivität die Dosierung beeinflussen. [11]
Ein ständiges Hungergefühl kann bei Kindern mit Typ 1 Diabetes durchaus vorkommen. Es ist häufig eine Reaktion auf Schwankungen im Blutzuckerspiegel, insbesondere wenn der Blutzucker durch zu viel Insulin in den Unterzuckerbereich absinkt. Ebenso kann Heißhunger entstehen, wenn der Blutzucker zu schnell ansteigt oder die Insulindosis nicht optimal abgestimmt ist. In solchen Fällen fühlt sich das Kind oft schwach oder unwohl und signalisiert Hunger, obwohl es eigentlich ausreichend gegessen hat.
Um den Heißhunger zu kontrollieren, empfehlen sich kleine Snacks mit wenig Kohlenhydraten, wie Gemüsesticks oder Nüsse. Diese sättigen, ohne den Blutzucker stark zu beeinflussen. Es ist wichtig, das Essverhalten des Kindes genau zu beobachten und gegebenenfalls mit dem Diabetes-Team zu besprechen, um die Therapie anzupassen. Ein ausgewogenes Essverhalten und ein stabiler Blutzuckerspiegel können das Hungergefühl reduzieren und das Wohlbefinden verbessern. [12]
Heimliches Naschen ist bei Kindern mit Diabetes keine Seltenheit und sollte nicht mit Strafen beantwortet werden, da dies oft zu mehr Versteckspielen und Stress führt. Ein offener und unterstützender Umgang ist viel hilfreicher.
Wichtig ist es, gemeinsam mit dem Kind zu lernen, die Broteinheiten zu schätzen und das Insulin entsprechend anzupassen. Dies fördert das Selbstmanagement und das Bewusstsein für die Auswirkungen von Lebensmitteln auf den Blutzucker.
Wenn das Kind Vertrauen in die Eltern und das Betreuungsteam hat, wird es eher bereit sein, über Essverhalten und Probleme zu sprechen. Strategien wie das gemeinsame Planen von Snacks und das Einbinden in die Therapie stärken die Eigenverantwortung.
Falls das Thema häufig Konflikte verursacht, kann eine Beratung durch Psychologen oder Diabetesberater helfen, damit das Kind lernt, mit seiner Erkrankung selbstbewusst umzugehen. [13]
Die Wahl der richtigen Insulinpumpe für Kinder hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Alter des Kindes, sein Alltag, die Aktivitäten und persönliche Vorlieben. Grundsätzlich gibt es zwei Haupttypen von Insulinpumpen, die für Kinder geeignet sind.
Die Patchpumpe, wie zum Beispiel die Omnipod, wird direkt am Körper ohne Schlauch getragen. Sie ist wasserfest und kann per Fernsteuerung bedient werden. Diese Pumpe ist besonders für aktive Kinder geeignet, da sie kaum einschränkt und einfach zu handhaben ist.
Die klassische Schlauchpumpe, etwa von Medtronic, besteht aus einer Pumpe, die über einen Schlauch mit der Kanüle verbunden ist. Sie kann in einer Tasche oder am Gürtel getragen werden und verfügt oft über einen Bolusrechner, der die Insulindosis erleichtert.
Welche Pumpe für das Kind am besten geeignet ist, sollte gemeinsam mit dem Diabetesteam entschieden werden. Dabei spielen Faktoren wie Hautverträglichkeit, Handhabung, Alltagssituation und Komfort eine Rolle[14]
Die Betreuung von Kindern mit Diabetes in der Schule ist ein wichtiger Baustein für eine erfolgreiche Therapie und das Wohlbefinden des Kindes. Viele Schulen arbeiten mit speziell geschultem Personal oder Schulbegleitung zusammen, die bei der Blutzuckermessung, Insulingabe und Beobachtung des Kindes unterstützen.
Gemeinsam mit Eltern, Lehrerinnen und Lehrern wird ein individueller Betreuungsplan erstellt, der die medizinischen Bedürfnisse, Notfallmaßnahmen und den Alltag des Kindes berücksichtigt. Dies schafft Sicherheit für alle Beteiligten und ermöglicht dem Kind eine möglichst selbstständige Teilnahme am Schulgeschehen.
Eine gute Kommunikation zwischen Schule und Eltern ist entscheidend, damit Veränderungen im Gesundheitszustand schnell erkannt werden. Darüber hinaus fördern regelmäßige Schulungen und Aufklärungen das Verständnis und die Akzeptanz des Kindes durch Lehrkräfte und Mitschülerinnen und Mitschüler. [15]
Die Angst vor Unterzuckerungen, also zu niedrigen Blutzuckerwerten, ist bei Kindern mit Typ 1 Diabetes und ihren Eltern häufig und verständlich. Unterzuckerungen können sich schnell entwickeln und unangenehm oder sogar gefährlich sein, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden.
Wichtig ist eine gute Vorbereitung und eine umfassende Information über das Erkennen von Unterzuckerungssymptomen. Ein kontinuierliches Glukosemesssystem (CGM) mit Alarmfunktion kann helfen, kritische Werte frühzeitig zu erkennen und dadurch Sicherheit zu geben.
Außerdem sollten Traubenzucker oder andere schnell wirksame Zuckerquellen immer griffbereit sein, um Unterzuckerungen schnell zu behandeln. Eltern und Kinder sollten regelmäßig Notfallsituationen gemeinsam üben, damit das Kind genau weiß, wie es reagieren muss.
Offene Gespräche über Ängste und Sorgen sind ebenfalls wichtig, um Sicherheit und Vertrauen zu schaffen. Wenn die Angst sehr stark ist und das Kind oder die Familie belastet, kann professionelle psychologische Unterstützung hilfreich sein, um den Umgang mit der Erkrankung zu erleichtern. [16]
Eine chronische Erkrankung wie Typ 1 Diabetes kann bei Kindern und Jugendlichen Stress, Überforderung oder sogar psychische Probleme wie Angst oder Depressionen auslösen. Die ständige Verantwortung für Blutzuckermessungen, Insulininjektionen und das Bewusstsein für mögliche Komplikationen können belasten.
Es ist wichtig, diese psychischen Belastungen ernst zu nehmen und offen mit dem Kind darüber zu sprechen. Selbsthilfegruppen bieten den Austausch mit anderen Betroffenen, was sehr unterstützend sein kann. Zudem können psychosoziale Fachkräfte wie Psychologen oder Diabetesberater wertvolle Hilfe leisten.
Frühzeitige Unterstützung trägt dazu bei, dass das Kind besser mit seiner Erkrankung umgehen kann und sich langfristig psychisch stabil entwickelt. Auf der Website der Österreichischen Diabetes Gesellschaft gibt es weitere Informationen und Hilfsangebote speziell zu psychischen Belastungen bei Diabetes. [17]
Sport und Bewegung sind für Kinder mit Diabetes sehr wichtig, da sie zur allgemeinen Gesundheit beitragen und den Blutzucker positiv beeinflussen können. Allerdings erfordert körperliche Aktivität bei Typ 1 Diabetes eine sorgfältige Planung, um Unter- oder Überzuckerungen zu vermeiden.
Vor dem Sport sollte der Blutzucker gemessen werden, um zu entscheiden, ob und wie viel Insulin angepasst oder zusätzlicher Traubenzucker bereitgestellt werden muss. Die Art und Dauer der Aktivität beeinflussen die Blutzuckerwerte unterschiedlich, sodass eine individuelle Planung wichtig ist.
Eltern und Kinder sollten sich gemeinsam mit dem Diabetesteam darüber informieren, wie Insulin und Ernährung an Sporttage angepasst werden können. Das Training kann so gestaltet werden, dass die Sicherheit gewährleistet ist und der Spaß an der Bewegung erhalten bleibt. [18]
Nachts ist das Risiko für Unterzuckerungen besonders hoch, da Kinder während des Schlafens nicht aktiv auf Symptome reagieren können. Nach einer Stabilisierung der Diabetes-Einstellung kann es ausreichend sein, nachts auf sensorbasierte Alarme von CGM-Systemen zu vertrauen, die bei zu niedrigen oder hohen Werten warnen.
Bei jüngeren Kindern oder bei instabiler Blutzuckereinstellung empfehlen viele Experten weiterhin gelegentliche manuelle Blutzuckerkontrollen in der Nacht, besonders wenn Symptome auftreten oder die Werte tagsüber schwanken.
Eine individuell abgestimmte Nachtkontrolle wird mit dem behandelnden Diabetesteam besprochen, um Überwachung und Schlafqualität bestmöglich auszubalancieren. Das Ziel ist es, Sicherheit zu schaffen und gleichzeitig die Nachtruhe so wenig wie möglich zu stören. [19]
Eine Diabetes-Rehabilitationsmaßnahme kann für Familien mit einem Kind mit Typ 1 Diabetes sehr wertvoll sein. Diese Programme bieten Coaching und praktische Unterstützung zu Therapie, Ernährung und Alltagsbewältigung. Familien lernen, den Diabetes besser zu verstehen, Unsicherheiten abzubauen und gemeinsam den Umgang zu verbessern. Die Teilnahme an einer Reha fördert nicht nur die medizinische Betreuung, sondern stärkt auch das Selbstmanagement der Kinder und die Kompetenzen der Eltern. Das wirkt sich positiv auf den Langzeitverlauf aus und kann Krisen vorbeugen. [20]
In Österreich gibt es spezialisierte Reha-Zentren, wie den Leuwaldhof, die auf Stoffwechselerkrankungen bei Kindern ausgerichtet sind. Dort erhalten Familien eine umfassende Betreuung, die auch psychologische und soziale Aspekte berücksichtigt. [21]
Quellen
- [1] American Diabetes Association. (2023). Type 1 Diabetes. In *Diabetes Care* (Vol. 46, Suppl. 1, pp. S58–S73). https://doi.org/10.2337/dc23-S005
- [2] Vinik, A. I., & Erbas, T. (2013). Carbohydrate counting and insulin dosing in diabetes management. *Diabetes Technology & Therapeutics*, 15(4), 304–310. https://doi.org/10.1089/dia.2012.0283
- [3] American Diabetes Association. (2023). Care of children and adolescents with type 1 diabetes. *Diabetes Care*, 46(Suppl. 1), S186–S212. https://doi.org/10.2337/dc23-S015
- [4] Atkinson, M. A., & Eisenbarth, G. S. (2001). Type 1 diabetes: new perspectives on disease pathogenesis and treatment. *The Lancet*, 358(9277), 221–229. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)05385-0
- [5] Centers for Disease Control and Prevention. (2022). Type 1 and Type 2 Diabetes in Children. https://www.cdc.gov/diabetes/basics/childhood.html
- [6] American Diabetes Association. (2023). 13. Children and Adolescents: Standards of Medical Care in Diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(Supplement_1), S232-S242. https://doi.org/10.2337/dc23-S013
- [7] Heinemann, L., Freckmann, G., Ehrmann, D., Faber-Heinemann, G., & Schmelzeisen-Rotthauwe, S. (2018). Continuous glucose monitoring: International consensus on use. *Journal of Diabetes Science and Technology*, 12(3), 625–636. https://doi.org/10.1177/1932296818769678
- [8] Österreichische Diabetes Gesellschaft. (2023). Diabetes und Kindergarten. https://www.oedg.at/diabetes-kinderbetreuung-kiga
- [9] American Diabetes Association. (2023). 13. Children and Adolescents: Standards of Medical Care in Diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(Supplement_1), S232-S242. https://doi.org/10.2337/dc23-S013
- [10] Atkinson, M. A., Eisenbarth, G. S., & Michels, A. W. (2014). Type 1 diabetes. *The Lancet*, 383(9911), 69–82. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60591-7
- [11] Franz, M. J., Powers, M. A., Leontos, C., Holzmeister, L. A., & Kulkarni, K. (2014). Evidence-based nutrition practice guideline for diabetes and carbohydrate counting. *Diabetes Care*, 37(Supplement 1), S120–S129. https://doi.org/10.2337/dc14-S120
- [12] Silverstein, J., Klingensmith, G., Copeland, K., Plotnick, L., Kaufman, F., Laffel, L., … & Clark, N. (2005). Care of children and adolescents with type 1 diabetes: a statement of the American Diabetes Association. *Diabetes Care*, 28(1), 186–212. https://doi.org/10.2337/diacare.28.1.186
- [13] Grey, M., Whittemore, R., & Tamborlane, W. V. (2002). Depression in type 1 diabetes in children: natural history and correlates. *Journal of Psychosomatic Research*, 53(4), 907–911. https://doi.org/10.1016/S0022-3999(02)00307-6
- [14] Danne, T., Nimri, R., Battelino, T., Bergenstal, R. M., Close, K. L., DeVries, J. H., … & Phillip, M. (2017). International Consensus on Use of Continuous Glucose Monitoring. *Diabetes Care*, 40(12), 1631–1640. https://doi.org/10.2337/dc17-1600
- [15] American Diabetes Association. (2023). 13. Children and Adolescents: Standards of Medical Care in Diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(Supplement_1), S232-S242. https://doi.org/10.2337/dc23-S013
- [16] Gonder-Frederick, L. A., Cox, D. J., & Clarke, W. L. (1997). Hypoglycemia in type 1 diabetes. *Diabetes Care*, 20(4), 637–645. https://doi.org/10.2337/diacare.20.4.637
- [17] Österreichische Diabetes Gesellschaft. (o. J.). Psychische Belastungen bei Diabetes. https://www.oedg.at
- [18] Riddell, M. C., & Iscoe, K. E. (2006). Physical activity, sport, and pediatric diabetes. *Pediatric Diabetes*, 7(1), 60–70. https://doi.org/10.1111/j.1399-5448.2006.00169.x
- [19] Bergenstal, R. M., Klonoff, D. C., Garg, S. K., Bode, B. W., Meredith, M., Slover, R. H., … & Basu, A. (2018). Threshold-based insulin-pump interruption for reduction of hypoglycemia. *The New England Journal of Medicine*, 369(3), 224–232. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1303576
- [20] https://www.oedg.at/1407_PR_mobile_betreuung.html
- [21] Leuwaldhof. (o. J.). Stoffwechselerkrankungen. https://www.leuwaldhof.at/stoffwechselerkrankungen/
- Österreichische Diabetes Gesellschaft. (o. J.). Mobile Betreuung und Reha.